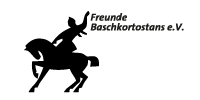Eine bevorstehende Operation ist wohl schon immer ein Grund zur Besorgnis gewesen. Die Angst vor den Schmerzen, die instinktive Angst vor dem Blut, ja, die Angst vor einem eventuellen „fatalen“ Fehler des (operierenden) Chirurgen – viele Menschen gehen im Kopf die schlimmsten Varianten durch, die unserer emotional aufgewuehlten Vorstellung nach während eines chirurgischen Eingriffs eintreten können. Man erinnert sich plötzlich ungewollt an die verhassten „RTL-Explosiv“ – Sensationssendungen, an die Reportagen über Pfusch-Ärzte, die ihr Operationswerkzeug im Leib der Patienten vergaßen; der Einfluß, den unsere sensationsgeile Medienlandschaft in unser aller Köpfen hinterläßt, wird in solchen Momenten ganz besonders spürbar – wir spüren ihn sozusagen am eigenen Leib. Die tagtäglichen Gräuelberichte über nachlässige Mediziner daheim, sowie über ganz besonders skandalöse Fälle aus dem Ausland, haben in unseren Köpfen eine bestimmte Vorstellung geschaffen, auch bei denjenigen, die nie zugeben würden, dass sie sich von Klatsch- und Skandalmedien beeinflussen lassen. Die (Pseudo-) Gewissheit, dass es bei uns in Deutschland den Berichten nach oft genug zu Ärztepfusch kommt, lässt uns automatisch schlussfolgern, dass es in Ländern mit wirtschaftlich schwächerer Lage noch wesentlich öfter zu schlimmen Fehlern des Personals kommt – immerhin sind die Kliniken und Krankenhäuser in den ärmeren Ländern lange nicht so gut ausgestattet wie unsere, und auch die Gehälter der Mediziner sind niedriger, weshalb sie sich in einer materiell schwierigeren Situation befinden und deshalb am Arbeitsplatz auch nervöser sind usw. Stopp Die Vorstellung des Durchschnittsdeutschen ist klar, inwieweit entspricht aber diese von den Medien, sowie unseren eigenen Lebensverhältnissen bestimmte Vorstellung der Realität?
Eine Frage, die ich mir oft genug stellte, kurz bevor ich mich selbst mit einer Blinddarmentzündung unters (chirurgische) Messer legen musste – und zwar nicht in Deutschland, und auch nicht in der baschkirischen Millionenstadt Ufa, sondern im Süden Baschkortostans, genauer gesagt in dem abgelegenen und trostlosen Städtchen Baimak – einem Ort mit einer fast schon einschüchternden Arbeitslosen- und nicht minder traurigen Abwanderungsquote.
Es passierte in dem, ethnisch gesehen, rein baschkirischen Dorf Baischewo unweit von der Kreisstadt Baimak entfernt. Ich hielt mich dort auf mit dem Ziel, der baschkirischen Sprache ein wenig näher zu kommen, da sich in Ufa viel zu selten die Möglichkeit ergab, baschkirisch zu sprechen – schließlich war und ist die Hauptkommunikationssprache in Ufa Russisch. Im Dorf Baischewo hatte ich nun in der Tat genügend Baschkirischpraxis, aber während des Aufenthaltes ergab sich ein anderes Problem; die größtenteils mit Fleisch zubereiteten baschkirischen Gerichte, die einen hohen Gehalt an Fett aufweisen, haben in meinem Organismus anscheinend eine Blinddarmentzündung provoziert – mein an solch eine Küche nicht gewohnter Magen hat rebelliert. Am gleichen Tag als die ersten Symptome sich bemerkbar machten (Magenschmerzen, Schwäche, Übelkeit) wurde ich von meiner Gastfamilie ins nächstgelegene Kreiskrankenhaus in Baimak gebracht. Es war schon nach 22 Uhr, als wir in die eine Stunde(!) mit dem Auto entfernte Kreisstadt losfuhren. Ich war mir irgendwie sicher, dass es nichts Ernstes ist und ich nach „ein paar Spritzen“ wieder zurück ins Dorf fahren kann – doch dies war nicht der Fall. Nach einer ersten Untersuchung des Chirurgen war klar, dass ich operiert werden musste
Eine Krankenschwester führte mich hinauf in den zweiten Stock in die chirurgische Abteilung der Klinik und wies mir ein Bett in einem insgesamt sieben Betten beinhaltenden Patientenraum zu. „Warte hier ein wenig – gleich wirst du operiert“, sagte sie und ging weg. Nach solch einer alarmierenden Nachricht schossen mir wie Blitze die verschiedensten Gedanken durch den Kopf. „Wo bin ich hier eigentlich gelandet?“, fragte ich mich immer und immer wieder und wollte nur noch weg. Der Schockzustand muss wohl größer als die Magenschmerzen gewesen sein, jedenfalls bildete ich mir urplötzlich ein, keine Schmerzen mehr zu haben und forderte die sofortige Entlassung aus der Einrichtung. „Ich habe keine Schmerzen mehr“, behauptete ich der Krankenschwester, nachdem ich hektisch zu ihr in den Flur der Abteilung rausgelaufen bin, „ich hatte ein bisschen Magenschmerzen, doch jetzt sind sie völlig weg“. Nach einem regen Disput schien sie überzeugt und ging wieder weg. Ich meinerseits kehrte in den Patientenraum zurück und legte mich etwas beruhigt auf mein Bett – die anderen Patienten waren bereits alle am Schlafen, denn ab 22 Uhr galt in der Baimaker Klinik Nachtruhe Einzig ein alter Mann, der gegenüber in der Ecke des Raumes lag, konnte wohl nicht einschlafen und fluchte lauthals herum. Mich haben seine Flüche nicht gestört, denn auch ich selbst hätte in diesem Moment am liebsten lauthals rumgeflucht, obwohl ich schon ein bisschen beruhigter war – der Opa „fluchte“ mir sozusagen aus der Seele. Meine inneren Flüche wurden wieder stärker, als ich den Chirurgen auf mich zukommen sah, denn ich habe bereits geahnt, was er mir sagen wollte. „Eine Operation ist unausweichlich, und zwar besser gleich als morgen, denn wenn der Blinddarm in der Nacht platzt, dann werden wir dir morgen gleich den ganzen Bauch aufschlitzen müssen Noch kann es bei einem kleinen Eingriff bleiben“. Er hatte mich!
Kurz nach dem Gespräch mit dem Chirurgen musste ich eine Einverständniserklärung zu einer Operation unterschreiben und spätestens da wurde mir bewusst, dass die OP unausweichlich ist. Nach der Unterschrift drückte mir die Krankenschwester eine Rasierklinge in die Hand und führte mich in einen Baderaum: „Rasier‘ dich, aber ohne Wasser!“. Sich immer noch in einem Schockzustand befindend, fragte ich gar nicht weiter nach und begann mich am Gesicht zu rasieren. Ich rasierte mich bloß und fluchte, fluchte, fluchte – über Gott und die Welt, darüber, welcher Teufel mich zu dieser „Studienreise in das Nirgendwo“ getrieben hat. Die Krankenschwester ließ angesichts meiner gereizten Selbstgespräche nicht mehr lange auf sich warten, kam herein und… lachte mich euphorisch aus. „Warum rasierst du dich am Gesicht?“, fragte sie fast an einem Lachkrampf zusammenbrechend, „befindet sich dein Blinddarm etwa nicht unten, wie bei allen anderen Menschen? Rasier‘ dich gründlich! Ich komme gleich und gucke nach!“. Sie lächelte mich an und ging wieder aus dem Baderaum. Alles klar. Da stand ich nun – mit heruntergelassenen Hosen und einer Rasierklinge in der Hand, verzweifelt und gedemütigt Die Wut packte mich wieder und ich stürmte aus dem Baderaum: „Ich werde mich dort nicht rasieren! Für wen halten sie mich? Ich mache mich hier zum Narren!“, schrie ich in den Flur herein und ging wieder in den Patientenraum. Die Krankenschwestern, mit solchen Situationen offenbar schon vertraut, haben nicht mehr versucht mich zu überzeugen und zogen sich zurück Die Einsicht, oder besser gesagt eine dumpfe Gleichgültigkeit trat von ganz allein ein. Egal, dachte ich mir, ich tue, was sie wollen, ich rasiere mich auch, wo sie wollen – Hauptsache die ganze Komödie nimmt ein Ende.
Ich ging also wieder in den Baderaum und danach raus in den Flur, um mich dem chirurgischen Eingriff nun endlich zu stellen. Die Krankenschwester rief mich sogleich in den Operationsraum und konnte nun endlich die Gründlichkeit meiner Rasur überprüfen, mit der sie überhaupt nicht zufrieden war. Mir selbst nicht mehr viel zutrauend, besserte sie selber nach – eigentlich hätte ich mich in diesem Moment wie ein Vollidiot fühlen müssen, doch dazu war ich viel zu angespannt. Die Operation jedenfalls verlief schnell und problemlos – im Nachhinein betrachtet war die Vorgeschichte viel spektakulärer als die OP selbst. Bereits am nächsten Tag konnte ich mich, zusammen mit den Krankenschwestern, die sich noch viele Tage später an meine Eskapaden vor der Operation mit Freude erinnerten, über mein aufgedrehtes, von Angst getriebenes Benehmen köstlich amüsieren. Überhaupt sah ich von nun an die Dinge viel lockerer und konnte meinem Alltag im Baimaker Krankenhaus mit Entspanntheit begegnen – denn ich blieb dort noch rund eine Woche zur Untersuchung und Erholung nach der OP.
Offiziell gab es im Krankenhaus klare Vorschriften und Regelungen; der Alltag der Patienten war zum Beispiel von Morgens bis Abends streng geregelt. Um 7.00 Uhr wurde jeden Tag geweckt, um 8.00 Uhr gefrühstückt, nach dem Frühstück wurden die Medikamente und Injektionen verteilt, um 10.00 Uhr fand der sog. ‚Obhod‘ statt, ein Rundgang des Chefarztes der chirurgischen Abteilung, usw. Doch in der Realität, wie es in Russland eben so ist, wurden die strengen Regelungen oftmals nicht allzu ernst genommen. Einzig vor den Chefärzten der Abteilung musste der schöne Schein gewahrt werden, obschon ich mir nicht vorstellen kann, dass die Chefärzte selbst nicht genau wussten, dass es eben nur ein Schein ist. Ich glaube, es ging hierbei mehr um Respektbezeugung, als um den Beweis, dass die Vorschriften wirklich eingehalten werden. So kamen jeden Tag vor dem ‚Obhod‘ die Krankenschwestern in den Patientenraum rein und wiesen uns, die Patienten, an, z.B. die am Hacken hängenden Jeans in die Schubladen zu verstecken, sowie Pullover auszuziehen – zumindest solange der Chefarzt da ist. Ich meinerseits konnte nur froh darüber sein, dass solch eine unsinnige Regelung, dass Hosen nicht an Kleiderhaken hängen dürfen, wenigstens nicht eingehalten wurde.
Von 15.00 bis 17.00 Uhr galt im Krankenhaus die sog. ‚Tihij Tschas‘ (russ. leise Stunde) und alle Patienten hatten während dieser Zeit in ihren Betten zu bleiben. Doch öfters haben wir Patienten lieber Karten gespielt, was im Krankenhaus übrigens gänzlich verboten war – das Kartenspielen ist in den öffentlichen Einrichtungen Russlands ganz und gar unerlaubt. Aus heutiger Sicht ein ziemlicher Irrsinn, doch zur Zeit der Sowjetunion, aus der dieses Gesetz stammt, galt das Kartenspielen als ein die Gemeinschaft verderbendes Glücksspiel Wie dem auch sei. Besonders fanatische Krankenschwestern waren offensichtlich immer noch von der Richtigkeit dieser Vorschrift überzeugt und haben immer wieder unseren Spielen ein Ende setzen wollen, und zwar nicht nur während der ‚Tihij Tschas‘. Schließlich wurden unsere Spielkarten konfisziert und zur Ablenkung blieb fast nur das überaus beliebte Anekdotenerzählen.
Der Opa, dem ich zum ersten Mal in der Nacht halb schlafend, halb herumschimpfend begegnete, erwies sich bereits am nächsten Tag als ein leidenschaftlicher Anekdotenerzähler und so erzählte er während meines Krankenhausaufenthaltes dutzende Witze, wobei seine Lieblingswitze sexistischer Natur waren – es waren solche Anekdoten, die man normalerweise nur von Jugendlichen hört Der scheinbar ewig junggebliebene Granny brachte immer wieder den ganzen Patientenraum zum Lachen. Ein wundersamer Mann, der trotz seiner zahlreichen gesundheitlichen Beschwerden stets munter blieb – oftmals munterer und fröhlicher als wir jungen Patienten, deren Gesundheitszustand um einiges stabiler war.
Eine weitere beliebte Beschäftigung unter den rauchenden Patienten, zu denen ich auch gehörte, war das Verstecksuchen für das Rauchen, denn Rauchen ist in allen öffentlichen Einrichtungen Russlands verboten. So mussten wir qualmenden Patienten uns immer neue Verstecke suchen, um nicht von den Krankenschwestern erwischt zu werden. Während dieser Versteckspiele verschwanden unter uns Patienten quasi die teilweise erheblichen Altersunterschiede – wie kleine Jungs rannten wir alle von den Krankenschwestern und Ärzten weg, als diese in bedrohliche Nähe unserer Verstecke kamen. Amüsante Situationen waren dabei fast vorprogrammiert. So lief ein Zimmergenosse von uns, der übrigens schon um die 50 Jahre alt war, in einen Aufzug rein, weil er diesen mit dem Ausgang verwechselte, und wurde so von einer Krankenschwester erwischt. Von nun an sagten wir anstatt ‚lasst uns rauchen gehen‘ nur noch ‚lasst uns in den Aufzug gehen‘. Übrigens wurden die erwischten Qualmer nicht etwa bestraft oder dergleichen – unsere Versteckspiele waren eher ein amüsante Ablenkung von dem Krankenhausalltag, als eine tatsächliche Notwendigkeit.
Alles in allem wurde mein unfreiwilliger Aufenthalt im abgelegenen Baimaker Kreiskrankenhaus zu einem kuriosen und unvergesslichen Besuch in der russischen Provinz. Natürlich ist es wahr, dass die provinziellen russischen Kliniken nicht so gut ausgestattet sind, wie die entsprechenden deutschen. Doch ist dieser Faktor für einen Patienten eigentlich von primärer Bedeutung? Menschliche Nähe, ein auflockerndes Gespräch, ein paar aufheiternde Worte, ja, eine kuriose Ablenkung – das ist es, was ein verunsicherter Mensch im angeschlagenen Zustand am meisten braucht, und das alles habe ich in diesem Krankenhaus gefunden. Und auch von der angeblich besonderen Niedergeschlagenheit der russischen Ärzte, die chronisch unterbezahlt seien, habe ich nichts zu spüren bekommen – die Besuche der Baimaker Ärzte in den Patientenräumen waren meist mit aufheiternden Worten und lustigen Geschichten verbunden. Es ist eine Kunst, die besonders in der russischen Provinz perfekt beherrscht wird, einen scheinbar grauen und unangenehmen Ort mit Leben und Witz zu füllen Die sowjetisch-monotone Einrichtung des Baimaker Krankenhauses mit den mich darin umgebenden Menschen wurde für mich zu einem Beispiel der russischen ebensfreude, und dieses Beispiel bleibt mir wohl auf ewig im Gedächtnis.
Sergey Simonov, Februar 2006