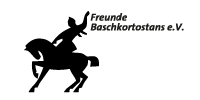Moskau war enttäuschend. Na ja, der Kreml ist schon beeindruckend. Aber sonst: Autos, Autos, Autos… Bleigeschwängerte Luft. Und wer von hier weiterkommen will, weiter nach Osten fliegen will, der ist auf den Inlandsflughafen Domodjedowo angewiesen (Anm. d. Red.: Mittlerweile fliegt Aeroflot von Sheremetjewo I nach Ufa, mit einem sehr bequemen, kostenlosen Bus-Transfer von Sheremetjewo II).
Die Verbindung dahin ist gar nicht so schlecht: Metro bis zur Endhaltestelle mit dem trügerischen Namen „Domodjedowo“. Immerhin: Von hier verkehrt ein Shuttle-Bus direkt zum Terminal. Fahrtzeit: eine Stunde. Landschaft: grüne Weiden, Kühe. Der Milchgürtel Moskaus. Noch 1.500 Kilometer westlich des Ural.
„Ural? Kommt da nicht der Kefir her? Ach nein. Das war ja der Kaukasus. Aber der ist doch die Grenze zwischen Europa und Asien! Auch nicht? Zeig mir das mal auf der Landkarte!“ hatten sie zu Hause gebeten. Dass der Ural für manche Leute ein derart weißer Strich auf der Landkarte ist…
Vielleicht weil Gerd Ruge noch keine Reportage über den Ural gedreht hat. Ob er jemals das schöne Plakat am Flughafen Ufa gesehen hat? Eine gemalte Bilderbuch-Landschaft, die mich ein bisschen an die Fix und Foxi-Comics meiner Kindheit erinnert: ein grünes Mittelgebirge, Wald, Wiesen, Hirsche, Bienenstöcke. Das muss der Ural sein. Ist das der Ural? Wir werden sehen. Dass uns so ein freundliches Plakat willkommen heißen würde! Und gleich auf Russisch und Baschkirisch!
Ufa ist die Hauptstadt der Autonomen Republik Baschkortostan, die außer der Belaja-Ebene praktisch den gesamten südwestlichen Ural umfasst. Statt Kefir trinkt man hier übrigens Stutenmilch. Und isst den Honig einer andernorts ausgestorbenen osteuropäischen Waldbienenart.
Den Honig hatte Damir ja schon mit nach Deutschland gebracht. Schmeckt noch intensiver als deutscher Waldhonig. Jetzt holt unser baschkirischer Freund uns bei strahlendem Sonnenschein vom Flughafen ab.
Berühmtheiten aus Ufa
Wir müssen nicht mit einem überfüllten Bus fahren: Damir hat seinen Freund Sergej als Chauffeur gewonnen. Die Straßen in die Stadt sind frisch geteert und autobahnartig ausgebaut. Links und rechts Bäume, Datschas, Babuschkas. Als wir auf die Brücke über den Belaja-Fluss zufahren, verschlägt’s uns fast den Atem: Wie gemalt schmiegt sich Ufa ans Hochufer der Belaja. Und hoch über der Stadt steht monumental Salawat Julajew, der baschkirische Nationalheld. Er nahm am Pugatschow-Aufstand gegen Katharina die Große teil, hat sich sonst aber mehr aufs Dichten verlegt.
Wir fahren gleich hoch zum Denkmal. Vorbei an alten Holzhäusern. In einem davon muss der berühmte tatarische Ballett-Tänzer Rudolf Nurejew aufgewachsen sein. Damir und Sergej wissen bloß nicht, in welchem. Am Denkmal ist gerade eine Hochzeitsgesellschaft: Die Brautjungfern ehren den Freiheitskämpfer mit Blumen. Er blickt dennoch recht grimmig drein auf seinem Ross. Vielleicht sind es aber auch nur seine mongolischen Gesichtszüge.
Um so lieblicher ist die Flusslandschaft zu Füßen des großen Baschkiren. Wo in Deutschland gibt es das noch? Kein Kanal, sondern eine sattgrüne Niederung mit Auwäldern, Altarmen und einem silbern blitzenden Fluss. Dazu ein ungewöhnlich trockener kontinentaler August mit 30 Grad.
Unterwegs holen wir noch Sergejs Frau Natascha von der Arbeit ab. Sie redet wie ein Wasserfall: „Wot wam Lenin! Wot wam Dserschinsky! Wot wam…!“ Die Stadt ist wirklich voller Denkmäler der Sowjetzeit. Im Gegensatz zu Moskau ist hier die Zeit stehen geblieben. Durchaus auch im positiven Sinne: Während Moskau im Dreck versinkt, sind in Ufa die Straßen gefegt, die Autos auf Hochglanz poliert und die Gegensätze zwischen Arm und Reich zumindest auf Anhieb nicht spürbar.
Denn die Holzhäuser sind nur außen hui. Und die Plattenbauten nur außen pfui. Von Damirs und Nataschas (nicht Sergejs Natascha!) Wohnung in einem solchen Plattenbau sind wir nun wirklich überrascht: Klein aber fein macht alles einen einladenden Eindruck. Hinter der himmelblauen Toilette hängt ein Regal voller Parfumflaschen.
Eine Woche dürfen wir hier baschkirisch-russische Gastfreundschaft erleben. Sie übertrifft alle Erwartungen und lehrt uns viel: Seither räumen auch wir unser Schlafzimmer für länger bleibende Gäste. Von wegen Klappsofa.
Nur langweilig wird es allmählich. Das soll sich in Kumertau ändern. Das liegt zwar immer noch nicht im Ural, aber deutsche Studenten treffen wir dort. Die müssen mit den Russen die Nächte durchfeiern, um morgens mit verquollenen Augen Straßen zu teeren. Ferienbrigaden nannte man diese schlafwandelnden Trupps schon zu Sowjetzeiten.
Langweilig ist das eigentlich nicht, aber eben nachts so laut. Wir wollen endlich den Ural sehen. Immerhin: Die Landschaft an der mittleren Belaja sieht aus wie aus einem Western. Das am Lagerfeuer gegrillte Schaschlik hilft sogar gegen Durchfall. Und von einer Übernachtung im Freien erhoffen wir uns die ersehnte Nachtruhe. Wir haben die Rechnung ohne die auch in Russland verbreiteten Auto-Stereoanlagen gemacht. . .
Zurück nach Ufa. Gepackt, geduscht, geschlafen. Um 2 Uhr morgens geht’s raus aus den Federn. Wenn der Bus Verspätung hat, könnte man ja den Zug verpassen. So warten wir also zu nachtschlafender Zeit über eine Stunde am Bahnhof.
Batjuschka Ural – Väterchen Ural
Dann ist es soweit: Wir fahren in den Ural. Der Zug Ufa – Magnitogorsk bietet den Komfort der dritten Klasse: Holzbänke. Dazu ein eingeschlagenes Oberfenster, das die ganze Fahrt über für genügend Sauerstoffzufuhr sorgt. Wir fahren durch eine erstaunlich flache Gegend. Um Ufa war es hügeliger.
Doch da erhebt er sich plötzlich aus der Ebene: Batjuschka Ural – Väterchen Ural. Majestätisch ist er nicht gerade, aber den Charme eines deutschen Mittelgebirges hat er schon. Deutsches Mittelgebirge? Je tiefer wir in den Ural fahren, desto mehr straft uns dieser Vergleich Lügen. Nicht wegen der Höhe der Berge: der 1640 Meter hohe Jamantau ist von hier aus nicht zu sehen. Nein: So viel Wald bis ans Flussufer, so wenige Siedlungen, so gar keine Industrie – das gibt es in Deutschland in keinem Mittelgebirge mehr. Und auch die Alpen sind zersiedelter.
Dabei ist das Tal der Inser durch die Eisenbahnlinie noch gut erschlossen. Straßen gibt es weit und breit keine. In anderen Tälern gibt es noch nicht einmal die Bahn.
Als wir die Inser überqueren, kommen mir schon Zweifel, ob Damir recht hat mit seiner Behauptung: „Hier kannst du das Wasser direkt aus dem Fluss trinken.“ Auf den Grund kann ich jedenfalls nicht sehen. Oder doch? Waren da aber nicht schaumige Stellen auf dem Wasser?
Ach was! Schaum kann natürliche Ursachen haben. Und bei der Bewölkung reicht das Sonnenlicht eben nicht bis auf den Grund. Wenn das Wetter so bleibt, graut mir vor der Schlauchbootfahrt. Dabei war es so ein Akt, die zentnerschweren Gummidinger sowjetischer Fabrikation zusammenzupumpen. Will heißen: aufzutreiben. Aufpumpen werden wir sie erst im Dorf Inser am gleichnamigen Fluss.
Die Inser – ein Äschen-Gewässer
Dort angekommen lassen wir unsere drei Boote zu Wasser. Die Sonne bringt es endlich an den Tag, dass das Wasser hier klar ist. So klar, dass wir unsere Dosen-Nahrung immer wieder mit dem empfindlichsten Süßwasserfisch Europas ergänzen können. Uneinigkeit herrscht unter den Einheimischen bloß darüber, ob wir die Äschen tatsächlich „im ortsüblichen Umfang“ angeln dürfen. Selten sind die Fische mit der hohen Rückenflosse hier jedenfalls nicht.
Wie gut es sich hier schläft, merken wir schon in der ersten Nacht. Erst frühmorgens ist ein Zug aus der Ferne zu hören. Doch mit Fischsuppe und Wodka im Bauch stört auch der wenig.
Vier solcher stillen Nächte sind uns vergönnt. Auf Zeltplätzen, die man in Deutschland als „wild“ bezeichnen würde. Von weitem sieht man sie zwar noch nicht, doch aus der Nähe wird klar, dass sich hier jeder nach Gutdünken sein Feuerholz einschlägt. Müll jeder Art wird verbrannt. Auch Dosen würden dabei so stark „anoxidiert“, versichert uns Narik, dass sie binnen weniger Wochen zu einem Nichts verrosten. Die stehen gelassenen Flaschen sammeln angeblich die Babuschkas ein. Der Verzicht der Inlandstouristen auf Flaschenpfand bessert ihre Rente auf.
Schon am zweiten Tag machen wir uns die Mühe, den Steilhang am gegenüberliegenden Ufer zu erklimmen. Zwei Kilometer ohne Weg und Markierung durch dichtes Unterholz.
Ein deutsches Mittelgebirge?
Der Ausblick entschädigt für den beschwerlichen Aufstieg: Das Maintal zwischen Odenwald und Spessart ohne Staustufen, ohne Industrie, ohne größere Ansiedlungen, mit noch erhaltenen Auwäldern. Wo es Felsen gibt, erinnert die Landschaft an die Fränkische Schweiz.
Insgesamt treibt uns der Fluss nur an drei Dörfern vorbei, in denen die Menschen, ohne von uns Notiz zu nehmen, ihrer Arbeit nachgehen. Den Anblick von Schlauchbooten sind sie gewohnt. Viele der Holzhäuser haben sogar Dach-Antennen. Im Fluss stehen immer wieder Angler: Er könnte die Menschen hier wohl schon allein durch seinen Fisch-Reichtum ernähren. Die Kühe auf den Weiden tun ein übriges.
Rudern müssen wir nur an einigen Stromschnellen. Bald stellt sich heraus, dass sie harmlos sind. Am dritten Tag ist es so heiß, dass wir immer wieder aus den Booten springen. Das Tal weitet sich. So versinkt die Abendsonne erst hinter den Bergen, als sie unsere Sachen getrocknet hat.
Am vierten Tag sehen wir immer mehr Menschen. Manche davon sprechen weder Russisch noch Baschkirisch. Sie verstehen auch keine der beiden Sprachen. Udmurten? Nicht weit von hier hat dieses finno-ugrische Volk schließlich eine autonome Republik. Stellenweise stauen sich an den Flussengen die Schlauchboote regelrecht. Manche der Paddler hatten wir auf dem Herweg im Zug gesehen.
Endgültig aus ist es mit der Idylle, als wir die stählerne Eisenbahnbrücke von Rawtau sehen. Bisher führten bestenfalls hölzerne Hängebrücken über den Fluss. Um Rawtau gibt es nun zwar Wiesen ohne Ende, aber nach einem ungestörten Platz für die letzte Nacht müssen wir zum ersten Mal suchen.
Nach einer letzten wodkaseligen Nacht schleppen wir die Gummiboote zum Bahnhof von Rawtau. Zweckmäßigerweise liegt der 2 Kilometer von Rawtau entfernt. Und wird zur Zeit renoviert. Jedenfalls deuten die langen Bretter darauf hin, die überall herumstehen. Personal? Fehlanzeige. So fahren denn später auch einige Bretter als Gepäck mit. Ein Lehrer aus Ufa dachte wohl an die Renovierung seiner Schule. Oder seiner Datscha.
Sowjet-Zivilisation, du hast uns wieder.
Thomas Trauth, 2002